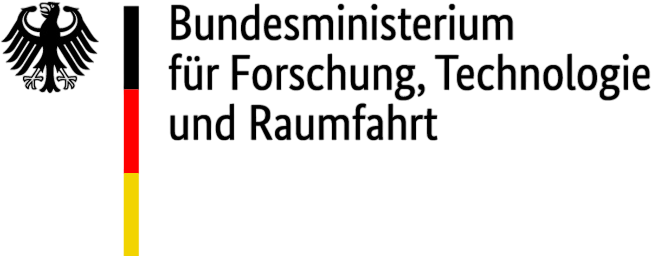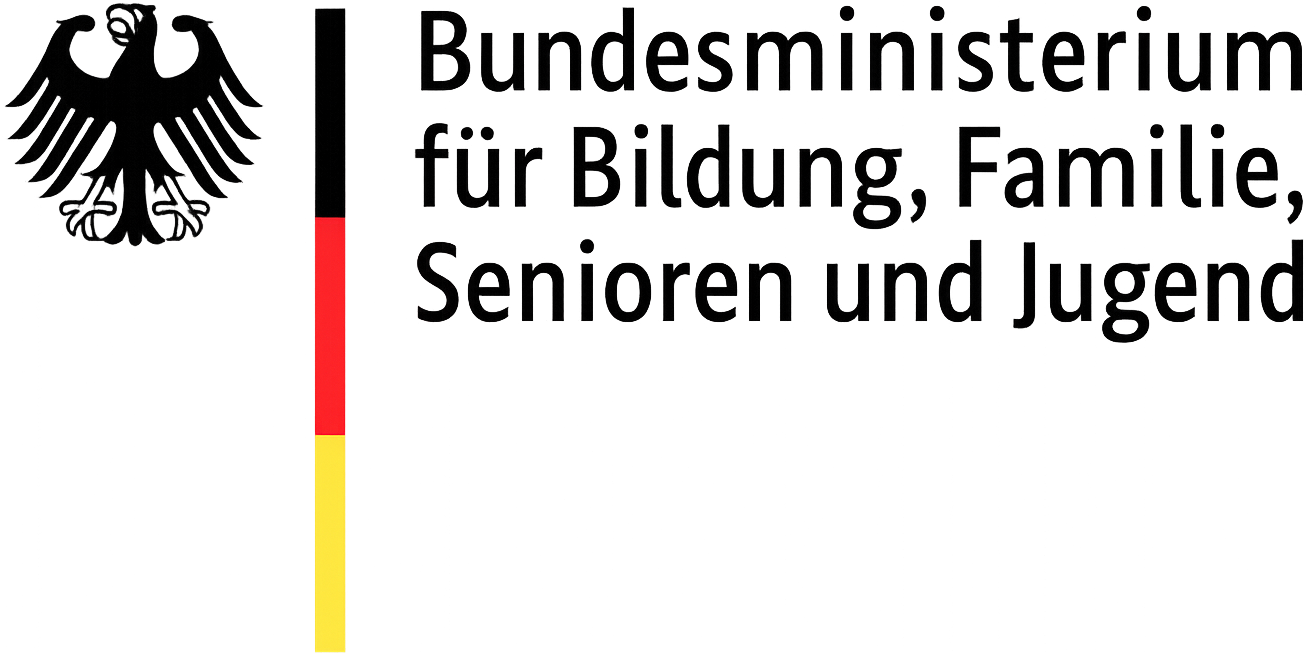Autor*innen
Organisation/Institut
Fachgebiet
Publikationsformat(e)
Projektstand
Projektbeginn
Projektende
Forschungseinrichtung(en)
Zentraler Phänomenbezug
Phänomenbereich
Lino Klevesath, Annemieke Munderloh, Marvin Hild, Joris Sprengeler
FoDEx
Radikaler Islam
Kurzstudie
Abgeschlossen
1. Januar 2021
29. April 2023
Universitär
Radikalisierung (allgemein)
Religiöse Ideologie
Zentrale Fragestellung:
Die vorliegende qualitative Interviewstudie hat sich die Aufarbeitung der Entwicklungen von der Entstehung bis hin zum behördlichen Verbot des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) und der zugehörigen Moschee als Aufgabe gesetzt. Um uns der Frage anzunähern, wie es zur Entstehung und Etablierung einer radikalislamischen Moschee mitten in der Hildesheimer Nordstadt kommen konnte, nehmen wir den »Hotbed«-Ansatz als Analysegrundlage. Demnach ist die geographische Verteilung der Herkunftsorte derjenigen, die zum Kämpfen in das Gebiet des IS ausreisten, keineswegs gleichmäßig verteilt, vielmehr stechen bestimmte Orte oder Stadtviertel hervor, in denen sich wiederholt auftretende, die Radikalisierung bedingende Faktoren identifizieren lassen. Die Studie fragt unter anderem: ■ Welche Faktoren des »Hotbed«-Ansatzes lassen sich in Bezug auf Hildesheim und insbesondere die Hildesheimer Nordstadt identifizieren? ■ Wie veränderte sich das Innenleben der Moschee im Zuge der stetigen behördlichen Überwachung der Moscheegemeinde? ■ Welchen Einfluss hatten die Entwicklungen um die DIK-Moschee, der behördliche Umgang mit ihr und die Medienberichterstattung auf das gesellschaftliche Miteinander in Hildesheim?
Stichprobenbildung – Datenzugang:
Forschungsinterviews im Frühjahr und Sommer 2021 mit Mitgliedern der lokalen muslimischen Community und ehemaligen Besucher:innen der DIK-Moschee, nicht-muslimischen Personen, die im direkten räumlichen Umfeld der Moschee wohnen, sowie mit Vertreter:innen von Behörden, Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Ergänzt wird das empirische Material durch eine Auswertung des Social-Media-Contents Abu Walaas, insbesondere seiner Telegram-Channels, sowie durch Aufzeichnungen diverser, von uns besuchter Gerichtstermine des Strafprozesses gegen Abu Walaa.
Gesamtstichprobengröße
Inhaltlicher / Thematischer / Empirischer Zentralfokus
Methodik
Erhebungsverfahren
Auswertungsverfahren
n = 9
Inhaltsanalyse
Zentrale Forschungsbefunde:
Die Studie kommt unter anderem zu folgenden Ergebnissen: 1. Die ehemalige DIK-Moschee in der Hildesheimer Nordstadt war ein dschihadistisches Hotbed, aus dem bis 2016 deutlich mehr Ausreisen in Richtung des Gebietes des „Islamischen Staates“ stattfanden als aus anderen Regionen Niedersachsens. Im Falle der DIK-Moschee waren die entscheidenden Faktoren das Vorhandensein eines charismatischen Anführers in Abu Walaa als Hauptimam der Moschee sowie ein hohes Maß an Peer-to-Peer-Interaktionen im Anwerbeprozess seines kleinen Kreises an Vertrauten, aus dem die Ausreisen stattfanden. 2. Die sozioökonomischen Problemlagen, die in der Hildesheimer Nordstadt identifiziert werden konnten, sind nicht spezifisch für dieses Stadtviertel, sondern sind in einer Vielzahl deutscher Städte auffindbar. Die lokalen Missstände waren also lediglich begünstigender Faktor, nicht aber zentrale Ursache für die Entwicklung der DIK-Moschee. 3. Dass sich die ehemalige DIK-Moschee ausgerechnet in der Hildesheimer Nordstadt ansiedelte, war keinesfalls zwangsläufig, sondern wurde durch Zufälle begünstigt. Vieles spricht dafür, dass die Moscheegemeinde ohne das Auftreten Abu Walaas eine zwar streng puristisch-salafistische, in Teilen auch politisch-salafistische, aber eben nicht dschihadistische Moschee geblieben wäre, von denen es in Deutschland einige gibt. Zudem darf die Tatsache, dass Abu Walaa die Moschee zu einem dschihadistischen Hotbed machte, nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich diese selbst zum Zeitpunkt ihrer Schließung nicht auf diese Eigenschaft reduzieren lässt.
Implikationen oder praktische Verwendbarkeiten:
Die Ereignisse um die DIK-Moschee zeigen, dass ein Präventionsansatz, der allein auf die Verhinderung der Radikalisierung von Individuen abzielt, zu kurz greift. Vielmehr gilt es, auch die Faktoren, die die Gründung salafistischer Moscheen begünstigen – wie etwa gesamtgesellschaftlichen antimuslimischen Rassismus, aber auch ein fehlendes deutschsprachiges Angebot und mangelnde Anschlussfähigkeit an die Jugendkultur seitens der großen Moscheeverbände – in den Blick zu nehmen. Es sollte eruiert werden, was etwa auch gemeinsam mit der muslimischen Community getan werden kann, um das gesellschaftliche Miteinander zu verbessern und die Herausbildung attraktiver alternativer religiöser Angebote für muslimische Jugendliche jenseits eines rigiden Salafismus zu befördern.
Hinweise / Anregungen zu möglicher Anschlussforschung:
Sofern in Zukunft wieder örtliche Ausreiseschwerpunkte von Personen, die zum Zwecke dschihadistischer Kämpfe ins Ausland reisen, identifiziert werden, lassen sich die Ursachen dieser Konzentration ebenfalls mit dem Hotbed-Ansatz untersuchen (gleiches gilt für örtliche Ballungen dschihadistischer Täter:innen, die ihre Taten im Inland verüben).
Zitation des Projekts
- Klevesath, Lino/Munderloh, Annemieke/Hild, Marvin/Sprengeler, Joris: Der ›Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim‹. Eine radikalislamische Moscheegemeinde im Kontext von Behörden und Stadtgesellschaft, FoDEx-Studie Radikaler Islam, Göttingen 2022.
Quellenangabe projektbezogener Publikation
- Klevesath, Lino/Munderloh, Annemieke/Hild, Marvin/Sprengeler, Joris: Der ›Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim‹. Eine radikalislamische Moscheegemeinde im Kontext von Behörden und Stadtgesellschaft, FoDEx-Studie Radikaler Islam, Göttingen 2022.