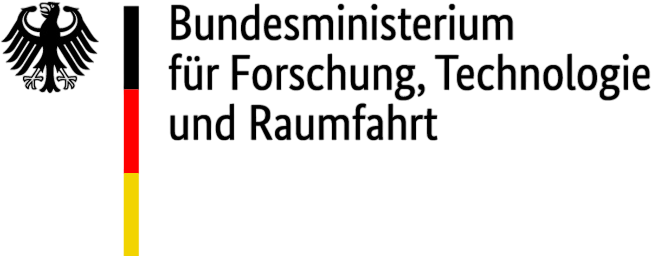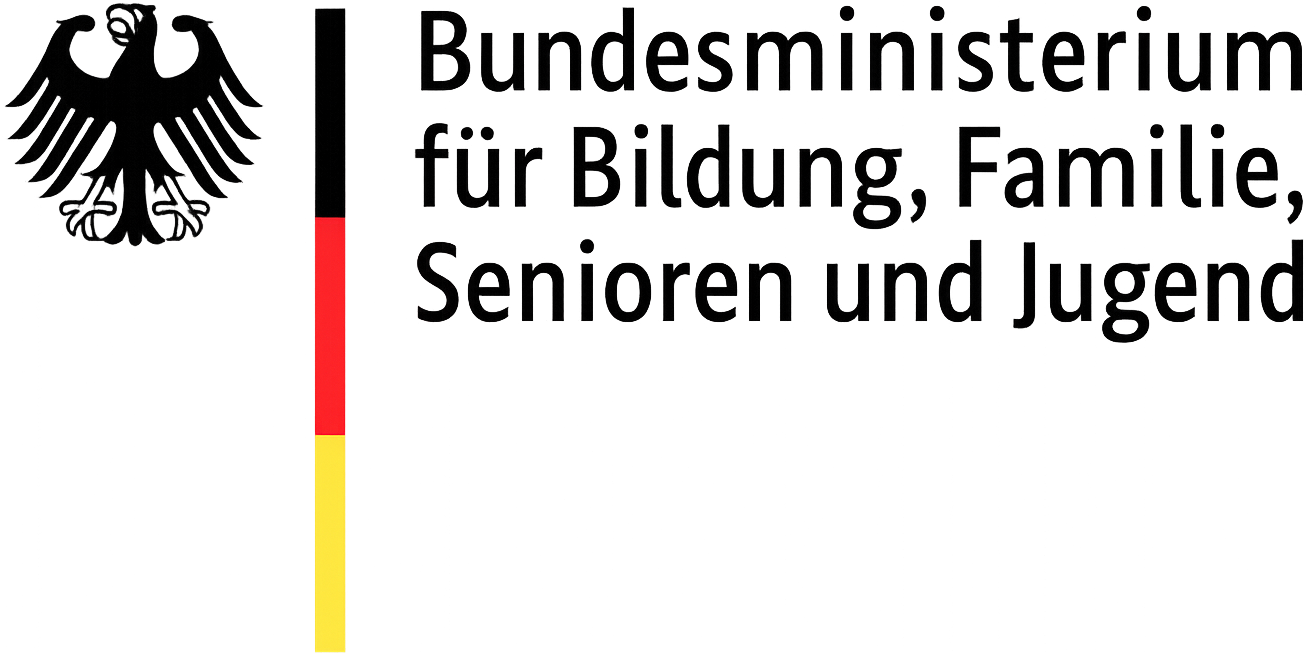Autor*innen
Organisation/Institut
Fachgebiet
Publikationsformat(e)
Projektstand
Projektbeginn
Projektende
Forschungseinrichtung(en)
Zentraler Phänomenbezug
Phänomenbereich
Fischer, Jannik; Endtricht, Rebecca; Farren, Diego
Universität Hamburg, Institut für Kriminologie
Kriminologie, Politikwissenschaft
Journal
/
/
/
/
Extremismus
Phänomenübergreifend
Zentrale Fragestellung:
Die General Strain Theory nimmt an, dass Konfrontationen mit sozialen Belastungen vor allem dann zur Etablierung normabweichender Verhaltensweisen und Einstellungen führen, wenn diese Belastungen mit negativen Emotionen verbunden sind. Extremismusaffine politische Einstellungen können solche Formen normabweichender Haltungen darstellen. In der vorliegenden Studie wird, anschließend an diese theoretischen Überlegungen, untersucht, ob (1) das Erleben kollektiver Marginalisierung die Wahrscheinlichkeit der Befürwortung extremismusaffiner politischer Einstellungen steigert und (2) inwieweit dieser Effekt über die Wirkungen damit verbundener negativer sozialer Emotionen zu erklären ist. Die theoretischen Annahmen werden anhand von Daten einer für die deutsche Wohnbevölkerung ab 18 Jahren repräsentativen Befragung (n = 4.483) überprüft. Im Wege von Strukturgleichungsmodellen wird untersucht, ob negative soziale Emotionen, hier gemessen über kulturelle Verlustängste, den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Marginalisierung der Eigengruppe (kollektive Marginalisierung) einerseits und demokratiedistanten, extremismusaffinen Einstellungen andererseits vermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Erleben kollektiver Marginalisierung wie erwartet mit einem signifikant erhöhten Risiko der Entwicklung demokratiedistanter, extremismusaffiner politischer Einstellungen einhergeht. Dieser Effekt wird vollständig durch mit kollektiver Marginalisierung assoziierten negativen sozialen Emotionen mediiert. Insoweit ist festzustellen, dass die Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Ausgrenzung und Benachteiligung der Eigengruppe zwar ein wichtiger Faktor zur Erklärung der Entstehung politisch-extremistischer Einstellungen ist, dieser aber zentral über interindividuell variierende emotionale Prozesse vermittelt wird. Neben sozial dysfunktionalen gesellschaftlichen Zuständen sind daher vor allem damit assoziierte negative Emotionen wie Ängste und Bedrohungserleben zentral zur Erklärung von politischen Extremismen, was auch für präventive Maßnahmen eine wichtige Feststellung bedeutet.
Stichprobenbildung – Datenzugang:
UHH-Forschungsbericht
Gesamtstichprobengröße
Inhaltlicher / Thematischer / Empirischer Zentralfokus
Methodik
Erhebungsverfahren
Auswertungsverfahren
n = 4483
Deskriptivanalyse, Multivariate Verfahren
Zentrale Forschungsbefunde:
/
Implikationen oder praktische Verwendbarkeiten:
/
Hinweise / Anregungen zu möglicher Anschlussforschung:
/
Zitation des Projekts
/
Quellenangabe projektbezogener Publikation
- https://doi.org/10.5771/2365-1083-2022-2-173