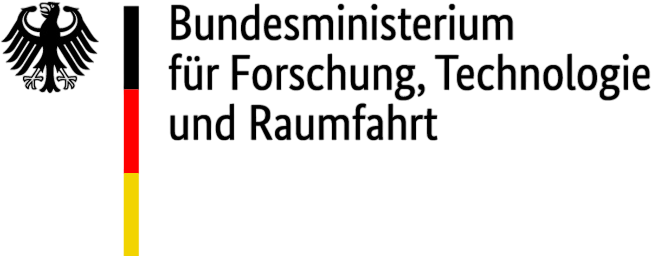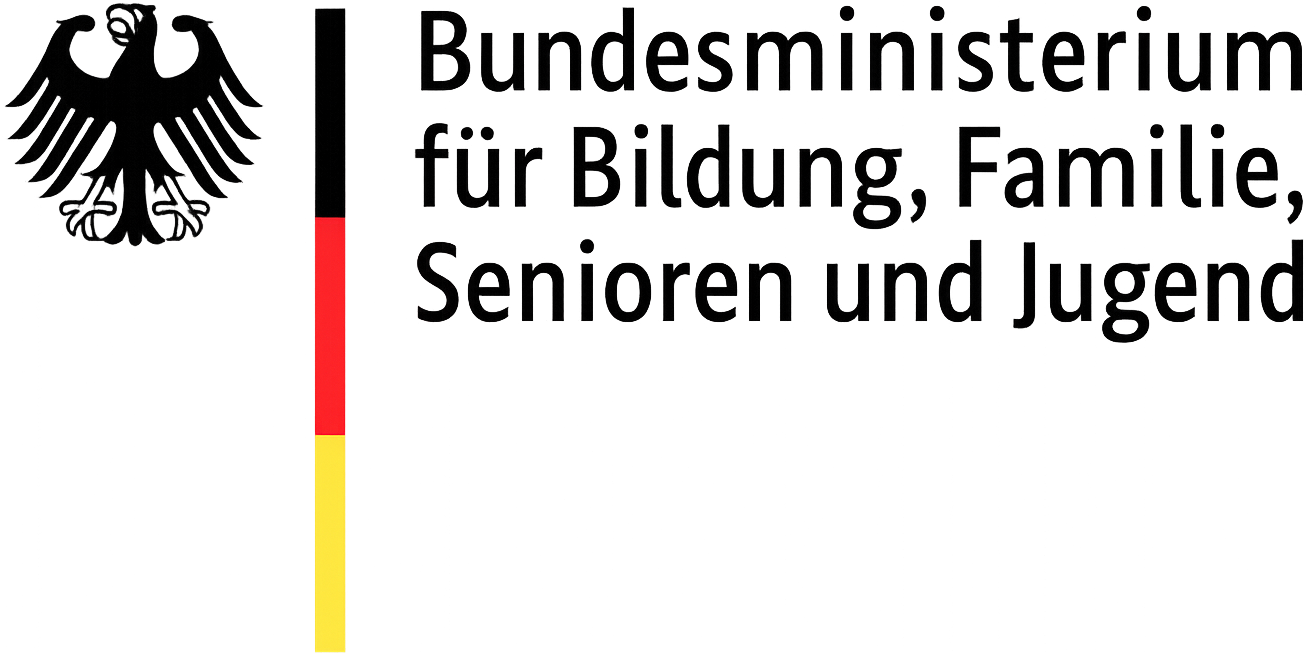Autor*innen
Organisation/Institut
Fachgebiet
Publikationsformat(e)
Projektstand
Projektbeginn
Projektende
Forschungseinrichtung(en)
Zentraler Phänomenbezug
Phänomenbereich
Fakhir, Zainab; Brandt, Leon A.
Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI)/ International Centre for Socio-Legal Studies (SOCLES)
interdisziplinär (Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Rechtswissenschaften)
Handlungsempfehlungen, Sammelband, Expertisen, Paper
Abgeschlossen
1. März 2019
31. Mai 2022
Radikalisierung (allgemein)
Zentrale Fragestellung:
Die bisherige Forschung zur Radikalisierungsprävention hat sich weitgehend darauf konzentriert, das Entstehen von Radikalisierungsprozessen mit Blick auf sich (potentiell) radikalisierende Personen zu untersuchen (vgl. z.B. Böckler/Zick 2015, RAN 2016). Dagegen ist die Rolle von Fachkräften in den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt mit (potentiell) radikalisierten Personen bisher weitgehend unerforscht. Das Projekt „RaFiK“ will mehr erfahren über Einstellungen und Handlungsorientierungen im Umgang mit religiös begründetem Extremismus und undemokratischen Milieus – sowie darüber, wie Fachkräfte praktische und ethische Dilemmata im Kontext von Kindeswohl und Religions- bzw. Meinungsfreiheit ausbalancieren. Der Fokus der Datenauswertung für diesen Beitrag bezieht sich auf die (religiöse) Identitätsentwicklung und die Lebenswelt der Heranwachsenden sowie den Schwierigkeiten denen Fachkräfte in der Abgrenzung von religiös strengen und religiös radikalen Verhaltensweisen der Heranwachsenden begegnen.
Stichprobenbildung – Datenzugang:
Rekrutierung von 38 Fachkräfte aus den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowie den angrenzenden Bereichen (bspw. Schule) – Datenzugang anhand der Vernetzung des Projektteams in den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowie einer Internetrecherche von pädagogischen Einrichtungen.
Gesamtstichprobengröße
Inhaltlicher / Thematischer / Empirischer Zentralfokus
Methodik
Erhebungsverfahren
Auswertungsverfahren
n= 38
Zentrale Forschungsbefunde:
Die Erkenntnisse aus diesem Beitrag wurden im Rahmen von Herangehensweisen und Herausforderungen ausgearbeitet, die sich auf den Umgang von Fachkräften mit den Thematiken Glaube, Religion und Religiösität beziehen. Das Datenmaterial des Projekts konnte aufzeigen, dass Fachkräfte sich mit den religiösen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen insbesondere dann befassen (müssen), wenn es um religiöse Radikalisierung geht. Dabei versuchen die Fachkräfte die Kinder und Jugendlichen anhand ihrer pädagogischen Arbeit sich einen Zugang zu den Jugendlichen (bspw. anhand der Beziehungsarbeit) zu verschaffen und so die Lebensweise der Jugendlichen mit Religion kennenzulernen. Dies ist insbesondere dann bedeutsam, wenn es darum geht eine mögliche Kindeswohlgefährdung erkennen zu können, wenn es Ambivalenzen in der religiösen Lebensweise der Eltern und den Jugendlichen gibt. Gleichzeitig lassen sich Konfliktsituationen von Seiten der Fachkräfte auffinden, die sich vor allem auf den Umgang mit ihren persönlichen religiös-weltanschaulichen Vorstellungen und der Glaubenswelten der Kinder und Jugendlichen sowie ihren Familien betrifft. Zusätzlich werden die Ergebnisse von einer rechtwissenschaftlichen Perspektive ergänzt, die unter anderem die Glaubensfreiheit der Eltern in der Erziehung sowie die Grenzen dieses Erziehungsgrundrechts in Anbetracht demokratiefeindlicher Vorstellungen aufzeigen.
Implikationen oder praktische Verwendbarkeiten:
Implikationen aus dem Projekt RaFiK: 1) Es ist Aufgabe der Sozialen Arbeit, Eltern mit streng religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen dabei zu unterstützen, einen geeigneten Weg zwischen Anpassung an die Gesellschaft und individuellen Gestaltungsräumen zu finden. Diese Aufgabe stellt sich insbesondere bei Aushandlungen des Kindeswohls. 2) Bei rechtsextrem eingestellten Kindern, Jugendlichen und Eltern haben Fachkräfte das Recht, sich gegenüber deren weltanschaulichen bzw. politischen Überzeugungen sowie den darauf fußenden Erziehungsvorstellungen zu positionieren, wenn dadurch das Kindeswohl und/oder die Rechte Dritter gefährdet oder verletzt werden. Aus diesem Recht wird eine Pflicht, wenn die Fachkräfte einen Schutzauftrag zu erfüllen haben. 3) Das Umfeld von religiös oder weltanschaulich radikalisierten Kindern, Jugendlichen und Eltern ist häufig unfreiwillig mitbetroffen, weshalb die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und angrenzender Bereiche (z. B. Schule) die Aufgabe haben, rechtlich schutzwürdige Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten im Blick zu behalten und ggf. zu schützen. 4) Die Erziehung eines Kindes jenseits freiheitlich- demokratischer Werte kann im Einzelfall eine Prüfung erfordern, um beurteilen zu können, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. 5) Die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren gesetzlich verankerten Regelstrukturen und die zivilgesellschaftlichen Träger der Radikalisierungsprävention, Deradikalisierung und Ausstiegsarbeit sind auf Vernetzung angewiesen, um ihre je eigenen Aufgaben angemessen erfüllen zu können.
Hinweise / Anregungen zu möglicher Anschlussforschung:
Die Forschungsergebnisse konnten nur die Ansichten eines bestimmten Teil der Fachkräfte aus den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe generieren. Die akquirierten Fachkräfte brachten bereits ein großes Interesse an dem Forschungsthema mit und waren affin in der pädagogischen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergund. Notwendig erscheint eine weiterführende phänomenübergreifende Erforschung der praktischen und ethischen Konfliktsituationen der pädagogsichen Fachkräfte in der Arbeit mit zu Extremismus neigenden Familien und ihren Heranwachsenden.
Zitation des Projekts
/
Quellenangabe projektbezogener Publikation
- Fakhir, Zainab/Brandt, Leon A. (2022): Religion als Bestandteil der Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. In: Zentrum für Analyse und Forschung (Hrsg.): Tagungsband der wissenschaftlichen Tagung des Zentrums für Analyse und Forschung des Verfassungsschutzes zum Tagungsthema „Extremismus und Sozialisation“. Köln